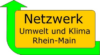Thematische Zusammenstellung, Hintergrundinformationen und Bewertungen anlässlich einer Veranstaltung bei HOLM am 3.11.2025 unter dem Titel „Nachhaltiger Luftverkehr: Globale Ressourcen und Kooperationen für Sustainable Aviation Fuels“ – von Karl-Heinz Peil
Thematische Zusammenstellung, Hintergrundinformationen und Bewertungen anlässlich einer Veranstaltung bei HOLM am 3.11.2025 unter dem Titel „Nachhaltiger Luftverkehr: Globale Ressourcen und Kooperationen für Sustainable Aviation Fuels“ – von Karl-Heinz Peil
Quellennachweis: Eigene Fotos, Grafiken zu den Einzelvorträgen aus den vorliegenden Präsentationen, eigene Grafiken zur Nachhaltigkeit
Alle Darstellungen sind aus Gründen der Übersichtlichkeit nur im Vorschau-Format aufgenommen – für volle Größe bitte anklicken.
| Dieser Beitrag ist noch eine vorläufige Fassung aufgrund der komplexen Thematik. Rückmeldungen an den Autor sind erwünscht. – 17.11.25 | |
Einleitung
In aktuell laufenden Debatten und politischen Entscheidungsprozessen wird der Flugverkehr als Wirtschaftsmotor hingestellt, der aber durch regulatorische Vorgaben, Abgaben und Standortkosten behindert würde. Mit der (zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrages geplanten) Senkung der Luftverkehrssteuer ab Mitte 2026 erweist sich die Luftfahrt-Lobby als erfolgreich. Dass dieser Effekt tatsächlich besteht, darf aus guten Gründen bezweifelt werden, wie eine jüngste Studie von T&E (Transport & Environment – Europas Dachverband für sauberen Verkehr und Energie) belegt. Gleichzeitig versucht man seitens der Politik und den Akteuren des Luftverkehrs, ein weiteres Wachstum als im Einklang mit definierten Zielen der EU zur Klimaneutralität darzustellen. Eine zentrale Rolle spielen hierbei die „Sustainable Aviation Fuels“ (SAF), deren Anteil am Flugbenzin nach EU-Vorgaben schrittweise erhöht werden soll. Die zentrale Botschaft, die damit verbunden ist, lautet: Klimaschutz ist technologisch machbar. Abgesehen von der totalen Überbewertung technologischer Maßnahmen zum Klimaschutz auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen ist eine derartige Dekarbonisierung im Luftverkehr jedoch definitiv nicht machbar. Dieses wird durch Akteure im Luftverkehr mit den Begriffen CO2-Neutralität, Klimaneutralität und einer Zweckentfremdung des Nachhaltigkeitsbegriffes verschleiert.
Anlass dieses Beitrages ist die Fachtagung „Nachhaltiger Luftverkehr“ vom 3.11.2025 – bereits die dritte Fachtagung dieser Art bei HOLM. Wegen der komplexen Thematik muss einem Bericht und einer damit verbundenen Kommentierung jedoch ein verständlicher Überblick über die Akteure, laufende Aktivitäten und Strategien vorangestellt werden, bevor auf Einzelbeiträge dieser Tagung eingegangen werden kann. Daran anschließend erfolgt eine Gesamtbewertung, welche vor allem tatsächliche Nachhaltigkeit beim Luftverkehr zugrunde legt.
Außen vor bleibt dabei – weil dieses den hier gesetzten Rahmen sprengen würde – dass bei Betrachtungen zur Nachhaltigkeit auch die permanenten Belastungen durch Fluglärm und Luftschadstoffe (im Rhein-Main-Gebiet) berücksichtigt werden müssten. Gesundheitliche Belastungen treten aber „nur“ als externe Kosten verdeckt in Erscheinung und wären an sich bereits ein Hauptkritikpunkt an der politischen Förderung des Flugverkehrs.
1. Akteure und Aktivitäten
HOLM wurde 2010 als Einrichtung des Landes Hessen (mit Beteiligung der Stadt Frankfurt am Main) gegründet. Der eigene Anspruch besteht gemäß Darstellung auf der Homepage darin, „mit Auftrag der öffentlichen Hand die unabhängige und neutrale Entwicklungs‑ und Vernetzungsplattform für die Zukunft der Logistik und Mobilität“ zu sein. Zu den ausgewiesenen 10 Premiumpartnern gehören:
- die Hessischen Flughafenbetreiber Fraport und kasselairport
- der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV), die Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VgF) und Hessen Mobil (zuständig für die Straßen-Infrastruktur in Hessen)
- mehrere Consultingunternehmen und der regionale Energieversorger Mainova
Eine Kooperation besteht auch mit der Frankfurt University of Applied Science und dem dort angesiedelten „IAT – Institute for Aviation and Tourism„, die sich auch bei der Veranstaltung am 3.11.25 mit Infostand präsentierte. Das IAT ist an der Hochschule am Fachbereich Wirtschaft und Recht angesiedelt und besteht seit 2020.
Wichtigster Akteur bei der hier behandelten Tagung und Thematik ist aber sicherlich CENA Hessen, 2020 gegründet mit Sitz am Standort von HOLM und tätig im Auftrag des Hessischen Wirtschaftsministeriums (HMWVW). In der Selbstdarstellung sieht man sich dem Klimaschutz im Luftverkehr verpflichtet, wie in einem Beitrag auf der Homepage auch detaillierter dargestellt unter Nennung der Nicht-CO2-Effekte des Luftverkehrs.
Bei der Veranstaltung am 3.11.25 waren außer den bereits genannten Institutionen mit Referierenden noch präsent:
- Institut für Katalyseforschung und -technologie (IKFT) – angesiedelt am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) der Technischen Universität Karlsruhe
- Hy2gen Deutschland GmbH mit Sitz in Wiesbaden
- Deutsches Biomasseforschungszentrum (DBFZ) mit Sitz in Leipzig
- Fraunhofer Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik (IEE) mit Sitz in Kassel
- PtX-Lab Lausitz
- Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH – in der Funktion als International PtX-Hub mit Sitz in Berlin
2. SAF: Grundlagen, Strategien, Status
2.1 Grundbegriffe
Hier zunächst einige wichtige Definitionen und kurze Erläuterungen:
Treibhausgase (THG): Diese werden meistens mit CO2-Emissionen gleichgesetzt, was aber generell nur bedingt der Fall ist, da auch andere Gase in der Atmosphäre entsprechende Wirkungen haben. Dabei handelt es sich meistens zwar um kleinere Mengen, aber mit teilweise wesentlich intensiverer Wirkung als THG. Speziell beim Flugverkehr spricht man von Nicht-CO2-Effekten, die in den atmosphärischen Schichten des Flugbetriebes eintreten. (Siehe dazu KI-Auskunft im Anhang).
PtX: Die PtX-Technologie nutzt Strom („Power“) aus erneuerbaren Energien, um grünen Wasserstoff und daraus „nachhaltige“ Kraftstoffe (z.B. für Luftfahrt) und Grundstoffe für die chemische Industrie herzustellen. Anstelle von PtX wird dafür vereinzelt auch der Begriff PtGLS (Power to Gas, Liquid, Solid) verwendet.
Für Wasserstoff als Rohstoff gibt es je nach Herkunft eine „Farbenlehre“ (grün, pink, blau, türkis, grau und weiß). An dieser Stelle sind nur zwei Varianten relevant:
- Grüner Wasserstoff, der durch Elektrolyse mittels Strom aus Windkraft- und Photovoltaikanlagen hergestellt wird
- Blauer Wasserstoff, der in der chemischen Industrie verfahrenstechnisch anfällt (z.B. im Industriepark Frankfurt-Höchst) und prinzipiell auch die Abscheidung und Speicherung von CO2-Emissionen ermöglicht
Für CO2 als Rohstoff gibt es zwei prinzipielle Varianten:
- Direct Air Capture (DAC): Eine direkte Entnahme von CO2 aus der atmosphärischen Luft erfolgt derzeit nur im Rahmen von Forschungsprojekten. (0,04% Volumenanteil in der Außenluft).
- Nutzung von Punktquellen aus Kraftwerken und Industrieprozessen, bei denen ein Volumenanteil von mehr als 10% CO2 in der Abluft genutzt werden kann. Beispiele: Abfallverbrennung, Zementherstellung, Biomassekraftwerk
Synthetic Aviation Fuels (e-SAF, auch e-Fuels oder reFuels), hergestellt mit zwei unterschiedlichen Power-to-Liquid-Prozessen (PtL), die im direkten Vergleich jeweils verfahrenstechnische Vor- und Nachteile haben:
- Fischer-Tropsch-Synthese
- Methanol-to-Jet (auch: Methanol-Route)
Aviation Biofuels (Bio-SAF): mit dem wichtigsten Produktionspfad HEFA (Hydroprocessed Esters and Fatty Acids)
2.2 Politische Strategien
Nationale Wasserstoffstrategie
Die 2020 erstellte und 2023 fortgeschriebene Nationale Wasserstoffstrategie beschreibt die Handlungsfelder, Zielbilder und Maßnahmen, um ausreichend verfügbaren Wasserstoff sicherzustellen. Dazu gehört auch der Aufbau einer umfassenden nationalen und europäischen Infrastruktur. Vor allem baut man auf Importe mit außereuropäischen Partnerländern. Anvisiert sind dabei sowohl pipelinegebundene Importe wie auch Schiffstransporte. Zu möglichen Problemen heißt es:
Essenziell ist u. a. neben der Einhaltung von Umweltstandards, wie der Vermeidung von Wasserknappheit und Verschmutzung, die Diversifizierung der Anbieter bzw. Produzenten von Wasserstoff über die aktuell energieexportierenden Länder hinaus. […] Der internationale Wasserstoffmarkthochlauf birgt zudem große Chancen für die deutsche Exportwirtschaft. Deutsche Unternehmen sind Marktführer bei Technologien, die für die Erzeugung und den Transport sowie die Nutzung und Rückverstromung von Wasserstoff benötigt werden. Der steigende Bedarf an Wasserstoff darf gleichwohl nicht dazu führen, dass lokale Wertschöpfung sowie Klima- und Umweltschutz in Entwicklungs- und Schwellenländern erschwert oder verhindert werden, oder dass bei Erzeugung und Transport Menschenrechte verletzt werden.
Wasserstoff als Rohstoff wird im Hessischen Koalitionsvertrag vom Januar 2024 wie folgt erwähnt:
Wir werden die Wasserstoffnutzung offensiv fördern. Mittelfristig werden wir dabei ausdrücklich auch in Produktionsprozessen anfallenden Nebenproduktwasserstoff nutzen. Unser langfristiges Ziel ist die Produktion und Nutzbarkeit von grünem Wasserstoff. Die Nutzung von Wasserstoff als Ersatz für fossile Brennstoffe in industriellen Prozessen erfährt unsere besondere Unterstützung.
EU: „Fit for 55“
Der Europäische Rat hat der EU das Ziel gesetzt, ihre Treibhausgasemissionen bis 2030 um mindestens 55 % gegenüber 1990 zu senken und bis 2050 klimaneutral zu werden. daraus wurde das Paket „Fit for 55“ mit einer Reihe von Rechtsvorschriften geschnürt. Durch das Europäische Klimagesetz sind diese Ziele für die EU und ihre Mitgliedstaaten verbindlich. Bis 2050 muss bei den in der Luftfahrt eingesetzten SAF ein Anteil von 50% synthetisch (e-Fuels) hergestellt werden.

Im Koalitionsvertrag von CDU und SPD in Hessen vom Januar 2024 heißt es:
Um die Wettbewerbsfähigkeit des Flughafens zu sichern, werden wir uns auch auf europäischer Ebene weiter mit Nachdruck dafür einsetzen, dass die dortigen Programme wie z.B. „Fit for 55“ zu keiner Wettbewerbsverzerrung führen und europäische Standorte im internationalen Vergleich schlechter gestellt sind. Wir setzen uns dafür ein, dass die Versorgung der Airlines mit SAF gemäß den EU-Quoten im internationalen Wettbewerb zu marktüblichen Preisen möglich wird und der Luftverkehr ausreichenden Zugang zu SAF in einem globalen „Level Playing Field“-Wettbewerb erhält.
Weiterhin heißt es explizit zum Flughafen Frankfurt:
Wir unterstützen die Bemühungen des Flughafens zur Dekarbonisierung. Dabei sind eine nachhaltige Stromerzeugung im Strommix erneuerbarer Energien, der Anschluss des Flughafens an das Wasserstoff-Fernleitungsnetz und die Weiterentwicklung emissionsfreier Bodenflotten von entscheidender Relevanz. […] Wir haben das Ziel, den Flughafen Frankfurt bundesweit zum Vorreiter für die E-Fuel-Technologie und nachhaltigen Luftverkehr zu machen.
Hightech-Agenda Deutschland
Mit dieser aktuellen Strategie des Bundesministeriums für Forschung, Technologie und Raumfahrt werden sechs Schlüsseltechnologien definiert:
- Künstliche Intelligenz
- Quantentechnologien
- Mikroelektronik
- Biotechnologie
- Fusion und klimaneutrale Energieerzeugung
- Technologien für die klimaneutrale Mobilität
Zu letzterem gehört als eines der ausgewiesenen Ziele:
Wir stärken Deutschland als Forschungs- und Entwicklungsstandort für Technologien für alternative Antriebe und klimafreundliche Kraftstoffe in Europa. Dadurch machen wir Deutschland perspektivisch zum globalen Leitanbieter und größten europäischen Technologie-Exporteur.
2.3 SAF-Status – eine Übersicht
In der Broschüre CENA SAF-Outlook 2025 – 2030 – Mengen, Methoden und Märkte für nachhaltige Flugtreibstoffe erfolgt eine kompakte Darstellung der Rolle von SAF im Luftverkehr, deren gegenwärtige und anvisierte Verfügbarkeit, sowie zum Status und der Realisierbarkeit von SAF-Projekten. Darin heißt es:
Trotz Zuwächsen bei den angekündigten Mengen bleibt der Markthochlauf von SAF hinter dem ab 2030 gemäß EU-Quoten erforderlichen Bedarf zurück – insbesondere synthetisches SAF wird durch hohe Produktionskosten ohne korrespondierende Abnahmebereitschaft der Airlines und regulatorische Unsicherheiten gebremst. Die mangelnde Investitionssicherheit in der frühen Marktphase verhindert den Bau notwendiger Referenzanlagen und hemmt langfristige Kostendegressionspotenziale. Um SAF als Schlüsseltechnologie zu etablieren, müssen alle Akteure gemeinsam handeln: Die Politik sollte regulatorische Hürden abbauen, Genehmigungsverfahren beschleunigen und durch Absicherungsinstrumente wie Bürgschaften und Erlösgarantien stabile Rahmenbedingungen schaffen. SAF-Produzenten und Investoren brauchen verlässliche Voraussetzungen für kapitalintensive Projekte mit langen Amortisationszeiten, während Airlines über langfristige, verbindliche Abnahmeverträge aktiv zum Markthochlauf beitragen sollten. Nur so können ein SAF-Markt in Europa aufgebaut und somit die ambitionierten Klimaziele im Luftverkehr erreicht werden.
Von den zahlreichen Darstellungen im CENA SAF-Outlook dürfte die hier beigefügte Grafik von besonderem Interesse sein.  Diese zeigt auf, dass bei der Gesamtzahl von SAF-Projekten die USA weltweit führend sind. Zusammen mit Deutschland sind dieses ca. ein Drittel aller weltweiten Projekte. Bezüglich der USA wird in der Broschüre darauf hingewiesen, dass die dortige Regulierungslandschaft bisher sehr vorteilhaft für Bio-SAF gewesen ist, unterstützt durch Maßnahmen der Biden-Administration, während sich jetzt durch die Trump-Regierung erhebliche Unsicherheiten bezüglich der langfristigen Unterstützung eingestellt haben.
Diese zeigt auf, dass bei der Gesamtzahl von SAF-Projekten die USA weltweit führend sind. Zusammen mit Deutschland sind dieses ca. ein Drittel aller weltweiten Projekte. Bezüglich der USA wird in der Broschüre darauf hingewiesen, dass die dortige Regulierungslandschaft bisher sehr vorteilhaft für Bio-SAF gewesen ist, unterstützt durch Maßnahmen der Biden-Administration, während sich jetzt durch die Trump-Regierung erhebliche Unsicherheiten bezüglich der langfristigen Unterstützung eingestellt haben.
Während bei fast allen Ländern die Projekte mit industrieller Produktion dominant sind, gilt dieses nicht für Deutschland. Dazu heißt es:
Während Deutschland weiterhin die meisten SAF-Projekte in Europa verzeichnet, handelt es sich dabei über wiegend um Pilot- und Forschungsanlagen, nicht jedoch um große industrielle Produktionsstätten. Dies ist auch bedingt durch zahlreiche ansässige Forschungszentren und Universitäten.
In diesem Zusammenhang ist beispielhaft die im Juni 2025 von der Fa. Ineratec im Industriepark Höchst offiziell eröffnete E-Fuel-Produktionsanlage zu nennen, die im CENA SAF-Outlook noch nicht genannt wird. Das CO2 stammt aus einer Biogasanlage, die Abfälle recycelt, und der (blaue) Wasserstoff ist Nebenprodukt aus einer Chloranlage.
Zu der Nutzung von biogenen Stoffen heißt es in dem Bericht des ifeu-Institutes im Rahmen eines Forschungsprojektes für das Umweltbundesamt:
Aus Nachhaltigkeitsaspekten sind die Ethanolherstellung und Biomassekraftwerke jedoch kritisch zu sehen. Beide Routen lassen sich zwar mit biogenen Abfall- und Reststoffen nutzen, werden heute aber in großen Anlagen überwiegend mit Anbaubiomasse oder Waldholz betrieben. Ein weiterer Ausbau dieser Prozesse ist aufgrund der meist in Monokultur angebauten Rohstoffe, der damit verbundenen negativen Umweltwirkungen und schwindender Waldsenken (u.a.) nicht wünschenswert. Eine Beschränkung auf biogene Abfall- und Reststoffe müsste mit erweiterten Nachhaltigkeitskriterien verbunden werden, um auszuschließen, dass die Verwendung der so deklarierten Reststoffe oder die Prozesse zur Bereitstellung dieser Reststoffe zu negativen Umweltwirkungen führen. Dabei besteht das Problem, dass viele biogene Reststoffe derzeit schon genutzt werden und alternative Nutzungspfade zur Biomasseverbrennung oft ökologisch vorteilhafter sind.
2.4 Alternative Szenarien für die Zukunft der Luftfahrt
Für die Zukunft der Luftfahrt ohne Einsatz von fossilen Brennstoffen gibt es neben SAF mehrere Szenarien:
Elektrofahrzeuge mit Batterien kommen bereits weltweit mit Drohnen für Lieferdienste zum Einsatz. Für den Transport von Passagieren wird der Einsatz jedoch auf kleine Passagierflugzeuge im Regionalverkehr von schwer zugänglichen Regionen beschränkt bleiben. Wollte man heute das Kerosin auf der Langstrecke durch Elektroakkus ersetzen, müsste man ein Vielfaches an Gewicht transportieren.
Bei Antrieben mit Wasserstoff als direkte Energiequelle in Flugzeugen werden zwei sehr unterschiedliche Varianten in Forschungsprojekten verfolgt. Eine solche Luftfahrt würde nicht nur völlige Neukonstruktionen von Flugzeugen, sondern auch eine sehr aufwändige Boden-Infrastruktur auf Flughäfen erfordern, d.h. riesige und nicht überschaubare Subventionen für die Luftfahrt. Größte Schwierigkeit sind sowohl im Boden wie auch in der Luft die erforderlichen Tanks für flüssigen Wasserstoff, der auf minus 253 Grad gekühlt werden muss. Die Optionen sind:
- Direktverbrennung von Wasserstoff in Gasturbinen, wobei Wasserdampf und Stickoxid entstehen, jedoch kein CO2. Derzeit zeigt selbst der Airbus-Konzern nach Voruntersuchungen kein Interesse an konkreten Plänen, wie von dem Unternehmen Anfang 2025 mitgeteilt wurde.
- Umwandlung von Wasserstoff und Sauerstoff in elektrische Energie (Brennstoffzellen), mit der Propeller direkt angetrieben werden. Hierfür gibt es mittlerweile Prototypen für Kurzstreckenflugzeuge, die evtl. nach Angaben aus der Industrie ab 2035 verfügbar sein könnten.
3. Kurze Übersicht der Fachbeiträge
3.1 Thematische Stichworte
Hauptinhalte der HOLM-Tagung mit mehr als 100 Teilnehmern am 3.11.2025 waren:
- Allgemeine Übersicht (wie im obigen Abschnitt dargestellt)
- Gegenüberstellung von technischen Produktionspfaden für Kraftstoffen aus biogenen Quellen und rein synthetische Verfahren, letzteres basierend auf „grünem“ Wasserstoff
- Zahlen zur Bedarfsentwicklung und Bewertung verfügbarer Ressourcen
- teilweise erfolgte Hinweise zur Sektorenkonkurrenz bei der Verwendung von Biomasse
- Regulatorische Rahmenbedingungen in der EU und deren Umsetzung in Deutschland
- global vorhandene Produktionsstandorte und internationale Kooperation
- Interessen, Wünsche und Optionen für eine deutsche SAF-Industrie
Die Einzelbeiträge der Veranstaltung waren nach dem Überblick durch den Referenten des PtX-Lab Lausitz strukturiert nach Feedstock (zugrunde liegende Rohstoffe) und Strategische Folgerungen (Globale Standorte und Wertschöpfung).
 In dem Vortrag von Matthias Lisson (Geschäftsführer von Hy2gen Deutschland GmbH) wurden die Schwierigkeiten von Bedarfsentwicklung und der abzuschätzenden Ressourcen benannt, wenngleich mit sehr vorsichtigen Formulierungen. Synthetische Produkte aus Wasserstoff in Deutschland sind nur möglich, wenn dieser „großvolumig“ direkt oder über Derivate (z.B. Ammoniak) importiert wird. Und: „Verfügbare Speiseölreste / Fette und auch Biomasse sind endlich“
In dem Vortrag von Matthias Lisson (Geschäftsführer von Hy2gen Deutschland GmbH) wurden die Schwierigkeiten von Bedarfsentwicklung und der abzuschätzenden Ressourcen benannt, wenngleich mit sehr vorsichtigen Formulierungen. Synthetische Produkte aus Wasserstoff in Deutschland sind nur möglich, wenn dieser „großvolumig“ direkt oder über Derivate (z.B. Ammoniak) importiert wird. Und: „Verfügbare Speiseölreste / Fette und auch Biomasse sind endlich“
3.2 Regulatorische Vorgaben
 Diese Thematik wurde übergreifend in mehreren Vorträgen behandelt. An dieser Stelle werden nur zwei Beispiele aufgeführt, die vor allem auf das Zusammenspiel von EU-Vorgaben und deren Umsetzung in Deutschland verweisen.
Diese Thematik wurde übergreifend in mehreren Vorträgen behandelt. An dieser Stelle werden nur zwei Beispiele aufgeführt, die vor allem auf das Zusammenspiel von EU-Vorgaben und deren Umsetzung in Deutschland verweisen.
 Erläuterungen von Abkürzungen in der Folie zu den regulatorischen Rahmenbedingungen:
Erläuterungen von Abkürzungen in der Folie zu den regulatorischen Rahmenbedingungen:
EU:
EU-ETS Emissionshandelssystem der EU
ReFuelEU Aviation: Verordnung zur Gewährleistung gleicher Wettbewerbsbedingungen für einen nachhaltigen Luftverkehr
Deutschland:
BImSchG: Bundesimmissionsschutzgesetz und für Luftfahrt relevante Verordnungen (BImSchV)
EnergieStG: Energiesteuergesetz (u.a. Steuerbefreiung von Kerosin) und entsprechende Verordnung
LuftVStG: Luftverkehrssteuergesetz (Besteuerung von Flugtickets)
3.3 Rohstoffgewinnung („Feedstock“)
 Zur Nutzung von CO2 als Rohstoff über Punktquellen erfolgte eine Übersicht durch Referentinnen von CENA Hessen und der Frankfurter UAS. Hervorzuheben ist deren Ermittlung der größten CO2-Punktquellen in Hessen aus Daten der Deutschen Emissionshandelsstelle (DEHSt), den Bestands- und Emissionsdaten der HLNUG (Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie) sowie dem deutschen Portal für transparente und frei zugängliche Emissions- und Abfalldaten THRU.
Zur Nutzung von CO2 als Rohstoff über Punktquellen erfolgte eine Übersicht durch Referentinnen von CENA Hessen und der Frankfurter UAS. Hervorzuheben ist deren Ermittlung der größten CO2-Punktquellen in Hessen aus Daten der Deutschen Emissionshandelsstelle (DEHSt), den Bestands- und Emissionsdaten der HLNUG (Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie) sowie dem deutschen Portal für transparente und frei zugängliche Emissions- und Abfalldaten THRU.
Ein Thema des Vortrages waren auch Transportnetzwerke, die ebenso im Kontext von Wasserstoff und CCS zu betrachten sind. Die Fokussierung auf Straße, Pipeline und Schiene für den Transport von CO2 zu möglichen PtL-Standorten ist dabei offenbar noch ganz am Anfang, wie dieses aus mehreren Einzelfolien hervor ging.
 Kati Görsch vom Deutschen Bioforschungszentrum (DBFZ) stellte die verschiedenen Konversionspfade für SAF im einzelnen dar. dazu gehörte auch eine Gegenüberstellung der beiden technischen Verfahren Fischer-Tropsch-Synthes und der Methanol-Route.
Kati Görsch vom Deutschen Bioforschungszentrum (DBFZ) stellte die verschiedenen Konversionspfade für SAF im einzelnen dar. dazu gehörte auch eine Gegenüberstellung der beiden technischen Verfahren Fischer-Tropsch-Synthes und der Methanol-Route.
 Ein weiteres Thema waren die benötigten Metalle, wobei sie sich auf eine vorliegende Studie bezog, bei der 15 Rohstoffe bzw. Rohstoffgruppen betrachtet wurde. Diese zeigte auf, dass allein der Bedarf für die SAF-Synthesen teilweise erhebliche Anteile der EU-Importe beanspruchen würden und damit ein erhebliches Versorgungsrisiko darstellen.
Ein weiteres Thema waren die benötigten Metalle, wobei sie sich auf eine vorliegende Studie bezog, bei der 15 Rohstoffe bzw. Rohstoffgruppen betrachtet wurde. Diese zeigte auf, dass allein der Bedarf für die SAF-Synthesen teilweise erhebliche Anteile der EU-Importe beanspruchen würden und damit ein erhebliches Versorgungsrisiko darstellen.
 In dem Beitrag (Karl-Friedrich Cyffka vom DBFZ) wurden die verfügbaren bzw. anvisierten Ressourcen kategorisiert nach den rechtlichen Vorgaben, mit denen die ganze Komplexität dargestellt wurde. Hierbei spielt die steigende Nachfrage von Biomasse in verschiedenen Sektoren eine zentrale Rolle – auch als Konkurrenz zu SAF.
In dem Beitrag (Karl-Friedrich Cyffka vom DBFZ) wurden die verfügbaren bzw. anvisierten Ressourcen kategorisiert nach den rechtlichen Vorgaben, mit denen die ganze Komplexität dargestellt wurde. Hierbei spielt die steigende Nachfrage von Biomasse in verschiedenen Sektoren eine zentrale Rolle – auch als Konkurrenz zu SAF.
3.4 Strategische Folgerungen
Vortrag von Dayana Grandford Ruiz, Wissenschaftliche Mitarbeiterin bei Fraunhofer IEE

Das Fraunhofer Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik (IEE) beschäftigt ca. 450 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Bereits seit Jahren besteht ein Power-to-X Potenzialatlas, in dem global vorhandene Standorte (für reFuels) nach verschiedenen Kriterien bewertet werden. Dabei handelt es sich um politische, ökonomische, soziale, technische und ökologische Faktoren. Dargestellt wurde in dem Vortrag, dass Chile besonders attraktiv ist, wegen niedriger Kosten für Solar- und Windenergie. Schwachpunkt dabei ist allerdings die prekäre Wasserversorgung in einer der trockensten Regionen weltweit, die durch bereits vorhandene Rohstoffausbeutung (vor allem Kupfer) ohnehin bereits verschärft ist. Die Referentin nannte dieses aber explizit „ein kleines Problem“, das man durch Meerwasser-Entsalzungsanlagen lösen könnte.
4. Gesamtbetrachtungen
4.1 Ökobilanz der SAF-Prozesskette
 Für eine strukturierte Bewertung muss der gesamte Ressourcenkreislauf mit den damit verbundenen Lieferketten gesehen werden. Als „klimaneutral“ kann man allenfalls ansehen, dass mit SAF im Flugbetrieb nur CO2 ausgestoßen wird, das vorher als Ressource für dessen Produktion der Atmosphäre entnommen wurde. Bei einer ganzheitlichen Betrachtung ergibt sich aber, dass man SAF bestenfalls als Kraftstoffe mit verminderter Wirkung der Treibhausgas-Effekte ansehen kann, da die atmosphärischen Nicht-CO2-Effekte bei der Verbrennung von SAF überwiegend erhalten bleiben (siehe Anhang). Nicht berücksichtigt bleiben dabei auch die Treibhausgas-Emissionen aus den vorgelagerten Prozessen sowie der massive Ressourcenverbrauch für Wasser. Diese Inanspruchnahme entsteht einmal zur Gewinnung metallischer Rohstoffe, die für Windkraft- und Solaranlagen sowie für verfahrenstechnische Anlagen zur SAF-Produktion erforderlich sind. Ebenso kann Wasserstoff als Rohprodukt dieser Verfahrenstechnik nur mit erheblichen Mengen von aufbereitetem, chemisch reinen Wasser produziert werden. Da beides zumeist in Ländern mit ohnehin prekärer Wasserversorgung erfolgen soll, ist eine negative Ökobilanz zwangsläufig. Beispielhaft lässt sich das an den ökologischen Problemen von Meerwasser-Entsalzungsanlagen aufzeigen, die dazu in großem Maßstab eingesetzt werden müssten.
Für eine strukturierte Bewertung muss der gesamte Ressourcenkreislauf mit den damit verbundenen Lieferketten gesehen werden. Als „klimaneutral“ kann man allenfalls ansehen, dass mit SAF im Flugbetrieb nur CO2 ausgestoßen wird, das vorher als Ressource für dessen Produktion der Atmosphäre entnommen wurde. Bei einer ganzheitlichen Betrachtung ergibt sich aber, dass man SAF bestenfalls als Kraftstoffe mit verminderter Wirkung der Treibhausgas-Effekte ansehen kann, da die atmosphärischen Nicht-CO2-Effekte bei der Verbrennung von SAF überwiegend erhalten bleiben (siehe Anhang). Nicht berücksichtigt bleiben dabei auch die Treibhausgas-Emissionen aus den vorgelagerten Prozessen sowie der massive Ressourcenverbrauch für Wasser. Diese Inanspruchnahme entsteht einmal zur Gewinnung metallischer Rohstoffe, die für Windkraft- und Solaranlagen sowie für verfahrenstechnische Anlagen zur SAF-Produktion erforderlich sind. Ebenso kann Wasserstoff als Rohprodukt dieser Verfahrenstechnik nur mit erheblichen Mengen von aufbereitetem, chemisch reinen Wasser produziert werden. Da beides zumeist in Ländern mit ohnehin prekärer Wasserversorgung erfolgen soll, ist eine negative Ökobilanz zwangsläufig. Beispielhaft lässt sich das an den ökologischen Problemen von Meerwasser-Entsalzungsanlagen aufzeigen, die dazu in großem Maßstab eingesetzt werden müssten.
4.2 Nachhaltigkeit im Luftverkehr
Nachhaltigkeit kann auf zwei Ebenen gesehen werden, die nachfolgend beispielhaft im Kontext Luftverkehr beschrieben werden. Erstens gemäß der aktuellen und immer noch maßgebenden Definition auf Basis des Brundtland-Berichts, der 1987 von einer UNO-Kommission veröffentlicht wurde. Nachhaltigkeit besteht danach aus den strategischen Elementen Suffizienz, Konsistenz und Effizienz.
Zweitens nach der spezifischen Bewertung von Nachhaltigkeit im Verkehrswesen bzw. der Mobilität, mit ähnlich gelagerten, strategischen Elementen.
Strategische Elemente von Nachhaltigkeit
 Wichtigstes Nachhaltigkeitselement ist die Suffizienz. Hierbei geht es um die Beschränkung der Ressourcennutzung für tatsächlich vorhandene individuelle und gesellschaftliche Grundbedürfnisse. Dabei kommt zwangsläufig die Frage nach einem Verzicht oder staatlich verordneten Beschränkungen in die Diskussion, was häufig zu emotional aufgeladenen Debatten führt. Festgehalten werden muss aber, dass es bei Suffizienz nicht um Einschränkungen der Lebensqualität geht, sondern „nur“ um einen maßvollen Umgang mit begrenzten Ressourcen. Das gilt vor allem auch für den Flugverkehr.
Wichtigstes Nachhaltigkeitselement ist die Suffizienz. Hierbei geht es um die Beschränkung der Ressourcennutzung für tatsächlich vorhandene individuelle und gesellschaftliche Grundbedürfnisse. Dabei kommt zwangsläufig die Frage nach einem Verzicht oder staatlich verordneten Beschränkungen in die Diskussion, was häufig zu emotional aufgeladenen Debatten führt. Festgehalten werden muss aber, dass es bei Suffizienz nicht um Einschränkungen der Lebensqualität geht, sondern „nur“ um einen maßvollen Umgang mit begrenzten Ressourcen. Das gilt vor allem auch für den Flugverkehr.
Konsistenz heißt, dass keine ökologische Überbeanspruchung von natürlichen Ressourcen erfolgt. Dies wäre bei einer erweiterten Nutzung von biogenen Quellen für SAF zweifellos der Fall wegen der begrenzten Landflächen und konkurrierender Nutzungen. Noch erheblich mehr gilt dieses für die Nutzung von Wasserstoff und der zumeist prekären Vorräte an Grundwasser. Meerwasserentsalzungsanlagen sind nur in kleinem Maßstab eine Alternative, wegen der ansonsten erheblichen Belastung der Meeresfauna in Küstenregionen.
Effizienz: Um Ressourcen aus erneuerbaren Energien effizient zu nutzen, müssen diese möglichst ohne große Umwandlungs- und Übertragungsverluste eingesetzt werden. Das ist beispielsweise der Fall, wenn die große Freiflächen-PV-Anlage des Flughafenbetreibers Fraport der Stromversorgung des Flughafens zugute kommt. Ebenso gilt dies für eine Belieferung mit Strom von Windparks in der Nordsee, die auf Investitionen der Fraport beruhen, wenngleich hierbei indirekt auch Übertragungskapazitäten in überdimensionierte Stromtrassen zu beachten ist. Mit der mehrfachen Umwandlung von grünem Strom über Elektrolyse-Wasserstoff und chemische Verfahren sowie dem letztlich thermischen Wirkungsgrad der Verbrennung in Flugzeugturbinen ergibt sich ein Gesamtwirkungsgrad des ursprünglich erzeugten Stroms von höchstens 20%. Optimal ist hingegen die Nutzung von grünem Strom beispielsweise bei dessen Einsatz in elektrisch betriebenen Bodenfahrzeugen auf Flughäfen.
Nachhaltigkeit in der Mobilität
Erstens: Vermeiden (im Sinne von Suffizienz)
Zu fragen ist stets nach dem tatsächlich vorhandenen individuellen und gesellschaftlichen Bedarf des Flugverkehrs. Fliege ich individuell nur deshalb, weil das Ticket so billig ist und ich deshalb alternative Urlaubsreisen ohne Flugzeug (zu teilweise wesentlich höheren Preisen) überhaupt nicht in Betracht ziehe?
Oder habe ich über große Distanzen familiäre Bindungen, die Flugverbindungen erfordern?
Entsteht Frachtgut deshalb, weil der Versand von billigen und nicht notwendigen Konsumartikeln (wie z.B. von Temu aus China) praktisch kaum in den Online-Verkaufspreis einfließt?
Oder ist bestimmtes Frachtgut als zeitkritischer Bestandteil einer notwendigen, globalen Lieferkette anzusehen?
Nur am Rande sei hier erwähnt, dass sich seit dem Corona-Lockdown endlich eine geschäftliche Kommunikation mit Videokonferenzen etabliert hat, die prinzipiell bereits seit Ende der 90er Jahre möglich gewesen wäre. Der Rückgang von Geschäftsreisen im Luftverkehr ist dadurch signifikant und wahrscheinlich dauerhaft.
Zweitens: Verlagern
Zu fragen ist: Können Kurzstreckenflüge nicht komplett durch ICE-Verbindungen tagsüber sowie bequemen Nachtzügen über größere Entfernungen ersetzt werden? Beispielsweise zeigt die monatliche Aufstellung der Stabsstelle für Fluglärmschutz bei der Stadt Frankfurt, dass von 17 Destinationen ab Frankfurt bis maximal 500 km Luftlinie aktuell nur 7 Destinationen tatsächlich einen Zeitvorteil bieten.
Komplexer ist die Verlagerung von Transportgut. Hierbei geht es z.B. um eine Verlagerung des Imports von Lebensmitteln auf regionale Produkte, d.h. um regionale statt globale Wirtschaftskreisläufe.
Drittens: Verbessern (im Sinne von Effizienz)
Durch moderne und treibstoffsparende Triebwerke lässt sich der Treibstoffverbrauch verbessern (und damit einhergehend zumeist auch die Lärmbelastung reduzieren). Dabei muss die Nachhaltigkeit aber auch unter Aspekten des Lebenszyklus eines Flugzeuges gesehen werden: Was passiert mit ausgemusterten Flugzeugen (Stichwort: Kreislaufwirtschaft)?
Eventuell kann auch eine Flugplangestaltung durch eine optimale Passagierauslastung pro Einzelflug die Gesamtzahl der Flüge reduzieren. Auf einzelnen Strecken gibt es auch konkurrierende Angebote von Fluggesellschaften, die zu einer reduzierten Auslastung führen.
4.3 Politische Rahmenbedingungen
Neben den aufgeführten Kritikpunkten aus fachlicher Sicht (Ökobilanz und Zweckentfremdung des Nachhaltigkeitsbegriffes) sind die Unsicherheiten der politischen Rahmenbedingungen – wie oben im einzelnen aufgeführt – ein eigener Kritikpunkt. Am deutlichsten wird das bei der theoretischen Option von Wasserstoffflugzeugen und der Anfang 2025 erfolgten Einstellung von entsprechenden Forschungs- und Entwicklungsarbeiten durch den Airbus-Konzern. Prinzipiell notwendig wären langfristig verbindliche politische Vorgaben, die aber vor allem in Deutschland nicht möglich sind. Im Unternehmens-Sprech (so auch auf der Veranstaltung am 3.11.25) nennt man dieses „Grandfathering„, auf deutsch: langfristiger Bestandsschutz für einmalig erfolgte rechtliche Vorgaben und Förderprogramme. Nur so wäre eine (schnelle) Umsetzung von SAF-Pilotprojekten – bei denen Deutschland weltweit führend ist – in industrielle Produktion möglich. Tatsächlich gibt es aber gerade in Deutschland ein auffälliges Missverhältnis zwischen Pilotprojekten und industrieller Produktion von SAF (siehe oben bzw. die entsprechende Grafik). Erklärbar ist das damit, dass in der Bundespolitik die wirtschaftspolitische Ausrichtung auf den Export von Technologien, gekoppelt mit dem Import von Rohstoffen, nach wie vor dominiert.
Dieses wird tendenziell noch verstärkt durch regionale Besonderheiten in Bundesländern und gilt vor allem für Hessen mit dem Flughafen Frankfurt, dem Industriepark Höchst und die Konzentration von SAF-relevanten Instituten im Rhein-Main-Gebiet. Deshalb finden sich z.B. auch im Hessischen Koalitionsvertrag zwischen CDU und SPD Passagen zum Ausbau der Wasserstoffwirtschaft in Bezug auf den Flughafen Frankfurt und den Flugbetrieb, die man nur als realitätsfremd bezeichnen kann.
Umso mehr gilt dieses für die Bundespolitik mit dem Wunschdenken, dass Deutschland in einer sich rasch verändernden Welt seine bisher vorhandene technologische Führungsrolle (in der Automobilindustrie, dem Maschinenbau und der chemischen Industrie) auf neu sich entwickelnden Märkten aufrecht erhalten könnte. Beispielsweise sagte Bundeskanzler Merz mit seiner Rede auf dem Treffen der Staats- und Regierungschefs im brasilianischen Belem, vorgeschaltet der eigentlichen Weltklimakonferenz COP 30, wie folgt zitiert (FAZ vom 8.11.25):
„Wir setzen auf Innovation und auf Technologie, um eben dem Klimawandel erfolgreich Einhalt zu gebieten. […] Unser Wirtschaft ist nicht das Problem. Unsere Wirtschaft ist der Schlüssel, um unser Klima noch besser zu schützen“.
Diese Aussage fiel im Kontext, dass er bzw. die deutsche Politik jetzt andere Akzente setzen wollten. Faktisch unterscheidet sich das jedoch wenig von den Zielen, die von Bündnis90 / Die Grünen vor der vorletzten Bundestagswahl formuliert und in der Ampel-Koalition mit der Zuordnung der Klimaschutzpolitik in das Wirtschaftsministerium auch praktiziert wurden.
4.4 Exkurs: Parallelen zur CCS-Technologie
Wie wenig sich letztlich die Politik der derzeitigen Bundesregierung gegenüber der Vorausgegangenen bezüglich Industrieförderung unterscheidet, wird am Beispiel der CCS-Technologie (Carbon Capture and Storage) deutlich. Die unterirdische Speicherung von CO2 soll dazu beigetragen, Deutschland bis 2045 „klimaneutral“ zu machen. Noch Anfang 2025 vom damaligen Wirtschaftsminister Habeck abgesegnet, wurde dieses Anfang November 2025 vom Bundestag in Gesetzesform auf den Weg gebracht. Dazu Wirtschaftsministerin Reiche:
Wir machen das Land damit zum Gestalter der Energiewende, zum Gestalter der Transformation, und zwar mit industriellen Anwendungen.
Von den zahlreichen Kritikpunkten seitens Umweltverbänden sei an dieser Stelle nur darauf verwiesen, dass durch das entsprechende Gesetz „ein breiter Einsatz von CCS auch für vermeidbare Emissionen“ ermöglicht wird und weiter:
Dies stellt eine Gefahr für wirkliche Emissionsminderung und die Transformation der Industrie dar und konterkariert den notwendigen schnellen Ausstieg aus fossilen Energieträgern.“
Die Parallelen zur (synthetischen) Produktion von SAF bestehen darin, dass die langfristige Existenz von CO2-Punktquellen unterstellt wird und damit umfangreiche Pipeline-Systeme aufgebaut werden müssten. Bei SAF wären dieses Produktions-Standorte wie für z.B. für Zement, bei CCS hingegen unterirdische Lagerstätten, was vor Ort jeweils nur mit einer aufwändigen technischen Infrastruktur möglich ist. Sowohl bei SAF wie auch bei CCS geht es damit um explizit benannte Industrieförderung, etikettiert als Klimaschutz.
5. Fazit
5.1 Warum die SAF-Ziele zum Scheitern verurteilt sind

Als Fazit ergibt sich, dass Anspruch und Wirklichkeit bei der Thematik „Nachhaltiger Luftverkehr“ mit SAF weit auseinander klaffen. SAF-Ziele bringen keine Klimaneutralität. Allenfalls wäre eine CO2-Neutralität rein theoretisch für die betriebliche Phase machbar, d.h. unter Ausklammerung der Nicht-CO2-Effekte des Flugverkehrs, was jedoch eindeutig eine Mogelpackung wäre. Umso weniger gilt das für den „ökologischen Rucksack“, der zur Herstellung für SAF mit Wasserstoff und CO2 aus Punktquellen notwendig ist. Der Aufwand an verfahrenstechnisch notwendigen metallischen und Wasser-Ressourcen ist immens und steht in Konkurrenz zu anderen Sektoren, in denen gleichfalls „Klimaneutralität“ angestrebt wird. Daraus ergibt sich:
- Die benötigten Mengen Wasserstoff wird es für einen SAF-Produktionshochlauf auch in einigen Jahrzehnten nicht geben. Die Herstellung von SAF ist deshalb ein Mengenproblem. Darin nur ein Kostenproblem zu sehen, das nach einem Produktionshochlauf und dann zu erwartender Kostendegression abgebaut werden könnte, ist irreführend.
- Für SAF aus biogenen Quellen sind die Ressourcen über die derzeitige Nutzung hinaus sehr beschränkt wegen der Flächen-Inanspruchnahme und der Konkurrenz zur Lebensmittelerzeugung, was deshalb ökologisch nicht vertretbar wäre.
- Für synthetisch hergestelltes SAF (e-Fuels) mit grünem Wasserstoff aus Strom von Windkraft- und Solaranlagen müsste ein Vielfaches der zur globalen Versorgung mit elektrischen Strom benötigten Anlagen errichtet werden. Dies ergibt sich aus dem extrem niedrigen Gesamtwirkungsgrad zur Herstellung von e-Fuels und stellt damit eine gewaltige Ressourcenverschwendung dar.
Das größte Problem ist aber wohl die Unkenntnis der Politiker, die von Luftfahrt-Lobbyisten zu Förderprogrammen und Subventionen gedrängt werden. Daraus ergibt sich eine Sichtweise von Ignoranz gegenüber Umwelt- und Klimaschutz und Illusionen über ökonomische Effekte, die sich nicht einstellen werden.
5.2 Was sind die Alternativen?
- Nachhaltigkeit muss verstärkt als primär gesellschaftliche Aufgabe verstanden werden. Dazu gehört auch, dass rein technologische Lösungen nur als ergänzende Funktionen wahrgenommen werden. Der Begriff „nachhaltiger Luftverkehr“ muss deshalb als Zeckentfremdung und Greenwashing bezeichnet werden.
- Umweltschädliche Subventionen müssen abgebaut und letztlich ganz beseitigt werden. In der vorliegenden Auflistung des Umweltbundesamtes genannt werden explizit die Energiesteuerbefreiung von Kerosin und die Förderung von Regionalflughäfen. Auch eine reduzierte Luftverkehrssteuer ist eine direkte Subventionierung.
- Alternativen zum Flugverkehr müssten institutionell entwickelt und für eine gesellschaftliche Anpassung mit Unterstützung der Politik verstärkt in den öffentlichen Diskurs eingebracht werden. Dieses muss auch unter dem Aspekt der globalen Klimagerechtigkeit gesehen werden. Wobei wiederum ein kleiner Anteil von Vielfliegern überproportionale Emissionen verursacht. Hier wären Einrichtungen wie das bereits bestehend IAT in Frankfurt am Main gefordert, das sich explizit mit „Luftfahrt und Tourismus der Zukunft“ befasst.
- Die angestrebte und notwendige Dekarbonisierung der Industrie bedeutet auch einen Übergang zur intensivierten Nutzung metallischer Ressourcen in technologisch anspruchsvollen Verfahren. Da diese teilweise erheblich begrenzter vorhanden sind als fossile Brennstoffe, ist deren sparsamer Umgang mit dem Ziel einer Kreislaufwirtschaft erforderlich. Dieses gilt in selbiger Weise für den damit einher gehenden Wasserverbrauch. Massiv eingesetzte Ressourcen in der Verfahrenstechnik für ineffiziente Umwandlungsprozesse basierend auf Wasserstoff müssen deshalb vermieden werden.
- Selektiv eingesetzte Forschungsgelder dürfen nicht mehr zur Korrumpierung der Wissenschaft führen, bei der die Probleme außerhalb des fachlich begrenzten Horizonts von Wissenschaftlern allenfalls unterschwellig thematisiert werden. Anwendungsorientierte Forschung und Pilotprojekte für die SAF-Produktion sind nur vertretbar, wenn SAF als eng begrenzt einsetzbares Nischenprodukt gesehen wird.
Anhang
A1: KI-Auskünfte
Non-CO2-Effekte des Flugverkehrs und SAF
Frage an DeepSeek V3: Welche wissenschaftlichen Erkenntnisse bestehen bei den Non-CO2-Effekten der Emissionen im Luftverkehr und inwieweit können diese durch Sustainable Aviation Fuels reduziert werden?
Die Non-CO₂-Effekte des Luftverkehrs sind komplex, aber wissenschaftlich gut erforscht. Sie machen etwa ⅔ der Klimawirkung der Luftfahrt aus (laut Berichten des IPCC und der EU Aviation Safety Agency). Hier die wichtigsten Effekte und der Einfluss von Sustainable Aviation Fuels (SAF):
1. Wichtige Non-CO₂-Effekte
- Kondensstreifen & Zirrusbewölkung: Flugzeuge erzeugen Eiskristalle, die Wärme in der Atmosphäre zurückhalten. Dieser Effekt könnte sogar stärker sein als der reine CO₂-Ausstoß.
- Stickoxide (NOₓ): Führen in großer Höhe zu Ozonbildung (erwärmend) und Methanabbau (abkühlend – aber netto überwiegt die Erwärmung).
- Rußpartikel: Begünstigen die Bildung von Kondensstreifen.
2. Reduktion durch SAF
SAF (z. B. aus Biomasse oder synthetischen Kraftstoffen) kann einige Non-CO₂-Effekte mindern:
- Rußemissionen sinken (bis zu 50–70% weniger Partikel, je nach SAF-Typ).
- Kondensstreifenbildung nimmt ab, weil SAF sauberer verbrennt.
- NOₓ-Emissionen bleiben ähnlich wie bei Kerosin, da sie stark von der Triebwerktechnik abhängen.
3. Grenzen von SAF
- Keine Lösung für Zirrusbewölkung: Selbst mit SAF entstehen Kondensstreifen, wenn die atmosphärischen Bedingungen passen.
- Kein vollständiger Klimaneutralitätseffekt, da auch SAF CO₂ ausstößt (wenn auch oft aus nachwachsenden Quellen).
Fazit: SAF reduzieren vor allem Ruß und damit Kondensstreifen, aber andere Effekte wie NOₓ oder Zirrusbewölkung bleiben eine Herausforderung. Langfristig braucht es Kombilösungen (effizientere Flugrouten, Wasserstoffflugzeuge etc.).
Quellen: IPCC (2022), EASA (2021), DLR-Studien.
Energetische Effizienz von SAF
Welcher technische Wirkungsgrad ergibt sich, wenn elektrischer Strom aus Windkraft- oder Solaranlagen zur Gewinnung von Wasserstoff und anschließenden Umwandlungsketten zu synthetischem Kraftstoff für Flugzeuge genutzt wird und wie ist der finale Wirkungsgrad als Antriebsenergie für Turbinen?
Antwort von DeepSeek (redaktionell gekürzt):
1. Elektrolyse (Strom zu Wasserstoff): Wirkungsgrad: 60–80 % (abhängig von der Technologie, z. B. PEM-Elektrolyse)
2. Fischer-Tropsch-Synthese (Wasserstoff zu synthetischem Kraftstoff): Wirkungsgrad: 50–70 % (abhängig von der Prozessführung und der Nutzung von Nebenprodukten wie Wärme)
3. Gesamtwirkungsgrad der Kraftstoffproduktion: 30–56 %
4. Wirkungsgrad der Flugzeugturbine mit thermischen Wirkungsgrad von etwa 35–40 %
5. Finaler Wirkungsgrad (Strom zu Antriebsenergie): 10,5–22,4 %
Quellen: Studien des DLR, Fraunhofer-Instituts und der IEA.
Antwort von ChatGPT:
Gesamtwirkungsgrad von Strom bis Wasserstoff (Power-to-Gas/Power-to-Liquids):
-
- Erzeugung erneuerbarer Strom: 40–50% (Netz- bis Anlagenwirkungsgrad variiert stark je Tech und Standort).
- Elektrolyse (Wasserstoff): 60–80% elektrische Effizienz (typisch 65–70% realistisch).
- Synthese von Kraftstoff (PtL/FT) aus H2 + CO2: thermodynamisch anspruchsvoll, Effizienz rund 40–60% je Prozesskette (oft ~50% als grober Richtwert).
- Gesamtwirkungsgrad Strom zu synthetischem Kraftstoff (LHV): ca. 12–25% insgesamt (Konservativ oft 15–20%).
Finale Antriebswirkungsgrad als Energie in Turbinen (Luftfahrt):
-
- Der chemische Kraftstoff liefert in der Verbrennung die nutzbare thermische Energie. Typischer Tank-to-Wheel-Wirkungsgrad (hier: Flugzeugantrieb, Turbine) liegt grob bei 40–60% je nach Typ, Betriebsprofil und Missionsstrategie.
- Kombiniert man PtL-Kraftstoff mit dem Turbinenwirkungsgrad, ergibt sich ein Gesamtwirkungsgrad vom Primärstrom (erneuerbare Energie) bis zur nutzbaren Flugzeugleistung von ca. 5–12% je nach Annahmen (oft 6–9% realistischer). Das bedeutet: große Verluste von der erneuerbaren Energie bis zur angetriebenen Flugleistung.
A2: Berichte, Broschüren und Studien
Daniel Münter, Horst Fehrenbach, Thomas Fröhlich ifeu – Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg gGmbH, Heidelberg: Optionen und Potenziale für die Nutzung von biogenem CO2 für die Herstellung von strombasierten erneuerbaren Energieträgern (August 2025)
Im Auftrag des Umweltbundesamtes – Quelle: https://doi.org/10.60810/openumwelt-7849
Umweltbundesamt: Umweltschädliche Subventionen in Deutschland (letzte Ausgabe: 2021)
von Dr. Andreas Burger und Dr. Wolfgang Bretschneider
Quelle: http://www.umweltbundesamt.de/publikationen
CENA Hessen: CENA SAF-Outlook 2025–2030 – Mengen, Methoden und Märkte für nachhaltige Flugtreibstoffe (Juni 2025)
Quelle: https://redaktion.hessen-agentur.de/publication/2025/4460_CENA_SAF_Outlook_2025-2030.pdf
IATA: SAF Handbook (Mai 2024)
Quelle: https://www.iata.org/contentassets/d13875e9ed784f75bac90f000760e998/saf-handbook.pdf
EASA: Europäischer Luftfahrt-Umweltbericht 2025 – Zusammenfassung und Empfehlungen (Jan. 2025)
Quelle: https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/eaer-downloads/EASA_EAER_2025_BROCHURE_WEB_de_v2.pdf
BMFTR: Hightech Agenda Deutschland (Juli 2025)
Quelle: https://www.bmftr.bund.de/SharedDocs/Publikationen/DE/L/31881_Hightech_Agenda_Deutschland.html
A3: Frühere Beiträge des Autors
Fraport: Nachhaltigkeit als Alibi (Okt. 2025)
Quelle: https://umwelt-klima-rheinmain.net/fraport-nachhaltigkeit-als-alibi/
Umweltpolitische Narrative und realer Handlungsbedarf (Feb. 2025)
Quelle: https://overton-magazin.de/hintergrund/wissenschaft/umweltpolitische-narrative-und-realer-handlungsbedarf/
Wieviel Kolonialismus steckt in Robert Habecks Energiepartnerschaften? (Okt. 2023)
Quelle: https://www.telepolis.de/article/Wieviel-Kolonialismus-steckt-in-Robert-Habecks-Energiepartnerschaften-9345124.html
Deutsche Energiewendungen: Vom EEG über Desertec zur Wasserstoffstrategie
und Energie-Partnerschaften und Nachhaltigkeitsziele der Agenda 2030 (Juli 2021)
Quelle: https://www.telepolis.de/article/Deutsche-Energiewendungen-Vom-EEG-ueber-Desertec-zur-Wasserstoffstrategie-6149528.html und (als zweiter Teil)
https://www.telepolis.de/article/Energie-Partnerschaften-und-Nachhaltigkeitsziele-der-Agenda-2030-6149532.html