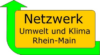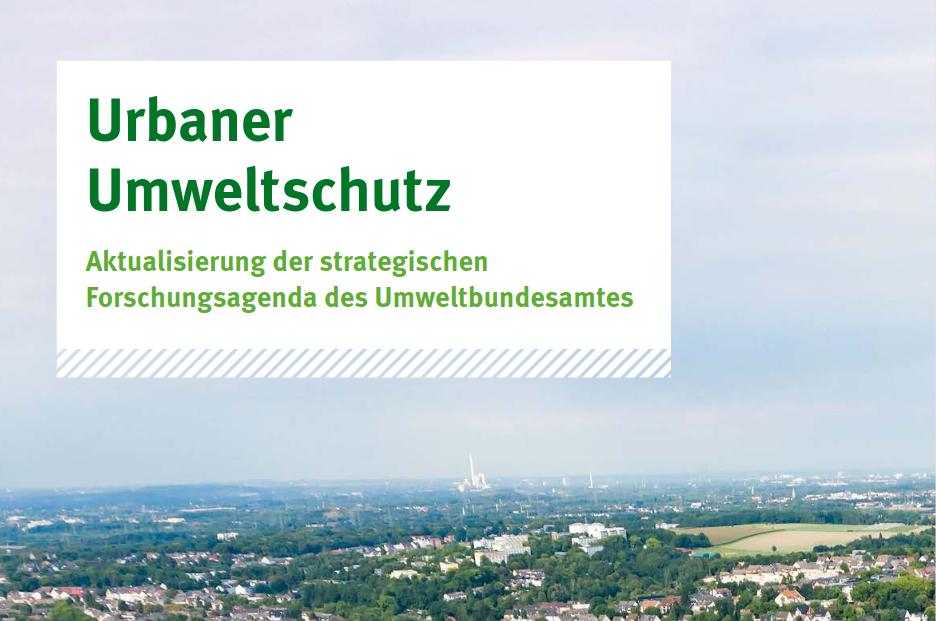Impulsbeitrag von Karl-Heinz Peil, BUND Frankfurt und Landesverband Hessen
Impulsbeitrag von Karl-Heinz Peil, BUND Frankfurt und Landesverband Hessen
Zu den Belastungen durch Luftschadstoffen zunächst ein kurzer Rückblick: Die auch für Frankfurt geltenden Umweltzonen mit Pkw-Plaketten dienten ursprünglich der Reduzierung von Feinstaubbelastung, die aus unterschiedlichen Quellen stammt, wobei z.B. Holzfeuerungsanlagen eine ebenso große Rolle spielen wie der Straßenverkehr in Innenstädten. Bei Letzterem hat sich der Fokus in den letzten 10 Jahren weitestgehend verlagert auf die Stickoxidbelastung, bei der Verbrennermotoren im Straßenverkehr die hauptsächliche Emissionsquelle sind.
Parallel mit der Reduzierung der Feinstaubbelastung durch die klassischen Partikelgrößen PM10 und PM 2.5 hat sich aber ein anderes Problem in den Fokus geschoben. Emittent ist hierbei nicht der Straßen-, sondern der Flugverkehr. Ultrafeine Partikel (UFP) sind für die unmittelbar Betroffenen eine noch erheblich größere Belastung als „klassischer“ Feinstaub und Stickoxide.
Bei früheren Klageverfahren der Deutschen Umwelthilfe erwies sich die Stadt Frankfurt als besonders hartnäckig und zeigte sich nicht wie beispielsweise Darmstadt und Wiesbaden mit Urteilen des Verwaltungsgerichtes Wiesbaden einverstanden. Erst nach einem langwierigen Verfahren vor dem Verwaltungsgerichtshof Kassel wurde 2020 der jetzt gültige Luftreinhalteplan für Frankfurt wirksam.
Wie kleinteilig, um nicht zu sagen kleinkariert man dabei seitens der Stadt Frankfurt vorging, kann an einem Beispiel erläutert werden. So verweist das Regierungspräsidium Darmstadt in dem Lärmaktionsplan von 2024 für Frankfurt auf seine Forderung nach einem schalltechnischen Gutachten zur Lärmbelastung an der Friedberger Anlage. Die Stadt hatte das aber abgelehnt mit dem Hinweis, das dort – auf Basis des Luftreinhalteplanes von 2020 – ohnehin bereits eine Tempo 40-Regelung vorhanden sei.
Mit Messstellen zur kontinuierlichen Erfassung der wichtigsten Luftschadstoffe ist es in Frankfurt relativ gut bestellt. An derzeit insgesamt 13 Messstellen der Hessischen Landesanstalt für Natur, Umwelt und Geologie (HLNUG) werden vor allem Stickoxidmessungen vorgenommen. Davon sind 8 Messstellen an Verkehrsschwerpunkten platziert und weitere 5 fallen unter die Rubrik „Städtischer Hintergrund“.
Bei den Stickoxiden werden zwar ebenso wie bei Feinstaub in den letzten Jahren die derzeit gültigen Grenzwerte eingehalten, jedoch werden an den gemessenen Verkehrsschwerpunkten die ab 2026 einzuführenden neuen Grenzwerte gemäß jetzt gültiger EU-Richtlinie um ca. 50% überschritten. Würde man sogar die 2021 von der WHO ausgegebenen Richtwerte zugrunde legen, wäre eine Überschreitung um das Dreifache bei Stickoxiden gegeben. Bedenklich ist aber vor allem, dass es in den letzten Jahren keine signifikanten Reduzierungen gab.
Der mit Abstand gefährlichste Luftschadstoff Ultrafeinstaub betrifft vor allem die Mitarbeiter der Bodendienste am Flughafen. Das Land Hessen hat sich dazu zwar zur Finanzierung zweier miteinander gekoppelten Studien bereit erklärt, jedoch mit einem sehr begrenztem Budget, das die Aussagekraft der Ergebnisse stark einschränken wird. Die vorgesehene Belastungsstudie zur Erfassung der Ausbreitung von UFP – von der vor allem der Frankfurter Stadtteil Schwanheim massiv betroffen ist – verspricht zwar im wesentlichen gute Resultate. Von der parallel dazu laufenden, medizinischen Wirkungsstudie kann man hingegen nicht den großen Wurf erwarten. Trotz der aus medizinischer Sicht signifikanten, besonders schädlichen Wirkung von UFP verschanzt man sich in der Politik und auch beim Flughafenbetreiber Fraport hinter nicht vorhandenen Grenzwerten, die es aber auch auf absehbare Zeit nicht geben wird.
Zu fordern ist, dass bei anderen internationalen Großflughäfen bereits praktizierte Lösungsansätze zur Reduzierung der bestehenden Belastung über das Land Hessen und die Stadt Frankfurt als gemeinsame Mehrheitsgesellschafter der Fraport politisch forciert werden.
Zurück zum innerstädtischen Bereich: Hier ist eine integrierte Infrastrukturplanung einzufordern, wie dieses ja auch im Masterplan Mobilität konzipiert ist. Ein Nebeneinander von z.B. Luftreinhalteplan und Lärmaktionsplan darf es nicht mehr geben. Notwendig wäre vor allem die Nutzung von Handlungsspielräumen für die Erweiterung von Tempo-30-Zonen entsprechend der seit 2022 bestehenden Forderung der Städteinitiative „Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeiten“. Im innerstädtischen Bereich muss eine drastische Verknappung von Stellflächen des ruhenden Verkehrs erfolgen, was überwiegend einer Begrünung zugute kommen kann. Daraus ergibt sich: weniger Straßenlärm und Luftschadstoffe, mehr Verkehrssicherheit und – gleichfalls gesundheitlich relevant – eine Verbesserung von Mikroklima und Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum.