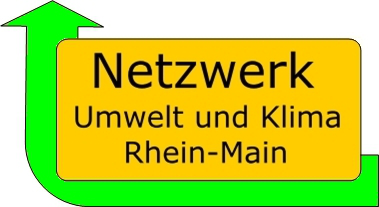Bewertung UFP-Projekt des FFR
UFP-Projekt:
Das erste Arbeitspaket ist fertig, das letzte will keiner haben.
Beitrag von der Homepage der BI Raunheim / Horst Bröhl-Kerner (Quelle: https://bifr.de)
Wie vor einem Jahr angekündigt, wurde das erste Arbeitspaket des Projekt SOURCE FFR jetzt termingerecht fertiggestellt und im FFR-Konvent präsentiert. Das Ergebnis kann auf der einschlägigen Projekt-Webseite in Form eines 85seitigen Berichts mit dem Titel „Bestimmung der UFP-Emissionen“ und einer Stellungnahme der „Wissenschaftlichen Qualitätssicherung“ dazu nachgelesen werden.
Der Bericht enthält allerdings nicht, wie es in der PM des FFR heisst, „die Ergebnisse zweier Messkampagnen auf dem Flughafengelände“ in dem Sinn, dass hier tatsächlich Meßwerte veröffentlicht würden.
Es geht im ganzen Bericht vielmehr darum, darzustellen, wie aus diesen Messungen und zahlreichen anderen Quellen Daten gewonnen werden, die es erlauben, „für die nun anstehenden Modellierungen der UFP-Immissionen …, die in den nächsten 12 Monaten durchgeführt werden (für die Jahre 2019 und 2024)“ die Emissionen aller relevanten UFP-Quellen als Input (sog. Emissionsfaktoren) zu erfassen.
Dabei werden relativ ausführlich Unsicherheiten in den Daten und mögliche Fehlerquellen dargestellt, zugrundeliegende Annahmen und Festlegungen begründet, etc.. Für Aussenstehende ist es schwierig zu beurteilen, aber man gewinnt den Eindruck, dass hier seriös gearbeitet wurde und Alternativen möglich, aber nicht unbedingt plausibler wären.
Zwei Punkte bleiben für uns allerdings unklar, und eine gravierende Auslassung fällt auf.
Im Kapitel „6.8 Emissionen des Flugverkehrs am Flughafen Frankfurt“ fällt auf, dass den Flugphasen unmittelbar am und auf dem Flughafen (landing-roll, taxi, take-off-roll) sehr grosse Aufmerksamkeit gewidmet wird, während die unmittelbar vorausgehenden bzw. folgenden Flugphasen (approach, climb-out) nur sehr summarisch behandelt werden. Bei letztere gibt es keinerlei Differenzierungen nach unterschiedlichen Lande- und Start-Verfahren, es bleibt auch unklar, wie weit sie überhaupt in die Modellierung einbezogen werden.
Auch die im Unterkapitel „6.8.4 Korrektur der Emissionshöhen durch Einwirkung von Wirbelschleppen“ beschriebene Behandlung der Wirkung von Wirbelschleppen wirkt sehr oberflächlich. Sie läuft darauf hinaus, die Triebwerksemissionen bei Modellierung von An- und Abflügen nicht in den tatsächlichen Flughöhen, sondern in durch vordefinierte Standard-Parameter bestimmten niedrigeren Höhen freizusetzen. Dass Wirbelschleppen als solche aufgrund der konkreten Wetterbedingungen erheblichen, auch seitlichen Transporten unterliegen und sich unterschiedlich schnell auflösen können, soll offensichtlich nicht berücksichtigt werden.
Wirklich schmerzhaft ist allerdings eine Auslassung, die dazu führen muss, dass die Qualität der Modellierung wesentlich schlechter überprüft werden kann und wichtige Aussagen über die Ausbreitung von ultrafeinen Partikeln aus Flugzeug-Triebwerken nicht gewonnen werden können.
Schon vor Beginn des Projekts war bekannt, dass sich UFPs aus Flugzeug-Triebwerken zumindest partiell von UFPs aus anderen Quellen chemisch unterscheiden, und es wurde in Aussicht gestellt, dass „die Ergebnisse der aktuellen Studie helfen, flughafenspezifische Partikel zu identifizieren und mögliche Minderungsmaßnahmen abzuleiten“.
Eine Ende letzten Jahres veröffentlichte Arbeit enthält auch Abschätzungen für Emissionen von aus Öl entstandenen UFPs in Abhängigkeit von diversen Flugparametern bzw. Flugphasen und beschreibt deren zeitliche Entwicklung, die sich anscheinend von der der UFPs aus Kerosin-Verbrennung unterscheidet.
In einer idealen Welt würde man davon ausgehen, dass solche Ergebnisse umgehend genutzt und in die Modellierung einbezogen würden, auch wenn sie zum Zeitpunkt der Konzeption der Studie noch nicht bekannt waren und zusätzliche Mittel dafür zur Verfügung gestellt werden müssten. Wenn die Emissionen von UFP aus Triebwerksölen charakteristisch für flugbedingte Immissionen sind, sind sie auch das ideale Mittel zur Unterscheidung von Immissionen aus verschiedenen Quellen und zur Bestimmung des Anteils der Flug-bedingten Immissionen an einem bestimmten Ort und damit für eine erfolgreiche Modellierung unverzichtbar.
Indem die Emissionen dieses UFP-Anteils in diesem Projekt nicht getrennt bestimmt und modelliert werden, wird also auf einen aktuell möglichen, wesentlichen qualitativen Fortschritt verzichtet. Zusammen mit dem Aspekt, dass auf die Untersuchung der spezifischen Toxizität dieser Immissionskomponenten von Anfang an verzichtet wurde, muss man schliessen, dass es dem Auftraggeber nur allzu recht wäre, wenn diese Zusammenhänge noch eine Zeitlang im Dunklen blieben.
Inwieweit es dem Institut Atmosphäre und Umwelt der Goethe-Universität, aus dem die oben zitierten Arbeiten kommen, das zum Projekt-Konsortium gehört und dessen Leiter auch der Projektleiter der Belastungsstudie ist, gelingen wird, die Erkenntnisse doch noch für das Projekt nutzbar zu machen, bleibt abzuwarten. Immerhin ist die „Chemische Charakterisierung von UFP“ mit dem Ziel der „Quellidentifizierung durch die Bestimmung von Markersubstanzen“ noch Teil des Arbeitspaketes 2 der Belastungsstudie.
Trotz der Mängel darf man hoffen, dass dieser Teil der SOURCE FFR-Studie brauchbare Ergebnisse liefern wird. Nächster Schritt sind laut Pressemitteilung „die nun anstehenden Modellierungen der UFP-Immissionen …, die in den nächsten 12 Monaten durchgeführt werden (für die Jahre 2019 und 2024)“. Ausserdem wird „mit der Veröffentlichung des Berichts für das zweite Arbeitspaket (UFP-Immissionsmessungen) … Ende des Jahres 2025 gerechnet“.
Spätestens dann wird man wissen, ob die Kritik an der Landesregierung wegen der Einstellung der temporären UFP-Messungen durch das HLNUG auch bezüglich einer Schädigung des Projekts SOURCE FFR berechtigt war. Im Zeitplan der Belastungsstudie, der im Konvent gezeigt wurde, tauchen die für Mitte des Jahres vorgesehenen „mobilen Messungen“ jedenfalls bisher nur mit Fragezeichen auf.
Wesentlich schlechter sieht es für den zweiten Teil aus, die Wirkungsstudie. In der PM heisst es dazu:
„Die Vergabeentscheidung für SOURCE FFR – exposure & health verzögert sich. Es ist geplant, die beiden aktuell vorgesehenen Module einer UFP-Wirkungsstudie in den nächsten Monaten zu vergeben. Das FFR ist zuversichtlich, dass die ersten Arbeiten an der Wirkungsstudie im September beginnen können.“
In einer Mail, mit der er eine Einladung zu einem weiteren „Austauschtreffen“ zum Projekt mit den BIs „nach den Osterferien“ ankündigt, schreibt der Leiter des Umwelthauses (das formal Auftraggeber der Studie ist),
„dass sich die Studienvergabe leider verzögert, da die öffentliche Ausschreibung aus dem Sommer 2024 erfolglos verlaufen ist. Die öffentliche Ausschreibung wird jetzt mit leichten Modifikationen erneut durchgeführt.“
Das muss wehtun.
Aus dem privaten Bereich kennt man das ja: man hat eine Arbeit zu vergeben, findet aber niemanden, der es macht, weil alle einschlägigen Handwerker zu wenig Leute und Besseres zu tun haben. Hier taugt das allerdings kaum als Erklärung.
Wenn staatliche (oder quasi-staatliche) Auftraggeber Forschungs-Dienstleistungen ausschreiben, gibt es in aller Regel nur einen begrenzten Kreis von meist finanziell wenig üppig ausgestatteten Instituten, die überhaupt in Frage kommen, und die meisten sind für neue Projekte dankbar. Wenn sich unter solchen Bedingungen niemand für ein Projekt interessiert, kann man sicher sein, dass damit etwas faul ist.
Schaut man sich an, was von der „Ausschreibung aus dem Sommer 2024“ öffentlich verfügbar ist, findet man einige Hinweise, was das sein könnte.
Die Seriosität dieser Ausschreibung wird schon beim ersten Durchlesen in Zweifel gezogen durch die vielen Schlampereien, die ins Auge fallen. So ist rund ein Viertel des länglichen Textes unter „2.1 Verfahren“ nur eine Wort für Wort identische Verdoppelung, und am Ende bricht die Beschreibung der 2. Teilstudie mitten im Satz ab genau da, wo es für die Wirkungsstudie interessant wird.
Wesentliche Inhalte werden dann unter „5.1 Los: LOT-0001“ beschrieben:
„Titel: Durchführung einer UFP-Wirkungsstudie Beschreibung: Die vorliegende Ausschreibung adressiert nur das 4. Teilvorhaben. Dabei sind folgende Forschungsfragen zu untersuchen: – Welche Auswirkung haben ultrafeine Partikel insbesondere aus dem Luft- und Straßenverkehrssektor auf die Gesundheit der Bevölkerung im Rhein-Main Gebiet? – Gibt es unterschiedliche Auswirkungen je nach UFP-Quelle? Wenn ja, welche? – Wie sind je nach untersuchtem Endpunkt die Wirkmechanismen zwischen UFP-Exposition und gesundheitlichen Folgen? – Gibt es Unterschiede in Abhängigkeit bestimmter Bevölkerungsgruppen? – Welche Bedeutung haben multiple Wirkfaktoren auf die Gesundheit, z.B. Kombination UFP/ Verkehrslärm oder UFP/ weitere Luftschadstoffe und meteorologische Parameter, wie z.B. UFP/Temperatur?“
Keine Rede also davon, dass die Studie schon von Anfang an enger begrenzt war und dann auch noch auf zwei Teilprojekte zusammengestrichen wurde – nach diesem Text wären praktisch alle Fragen zu untersuchen, die einem im Zusammenhang mit diesem Thema überhaupt einfallen können.
Sollte es potentielle Anbieter geben, die bisher mit dem Projekt noch nichts zu tun hatten, würden sie wohl durch solche Anforderungen erfolgreich abgeschreckt.
Faktisch ist es aber wohl eher so, dass alle, die für die Durchführung dieses Studienteils hierzulande überhaupt in Frage kommen, schon an der Ausarbeitung der Designstudie beteiligt waren und genau wissen, worum es wirklich geht. Sie sehen sich dann mit der Situation konfrontiert, dass einerseits die Auftraggeber öffentlich immer noch gigantische Erwartungen produzieren, indem ein gewaltiger Umfang der Untersuchungen vorgetäuscht wird, andererseits aber die tatsächliche Aufgabe und die dafür zur Verfügung stehenden Mittel extrem eingeschränkt sind.
Die Perspektive, in der Öffentlichkeit nach Abschluss des Projekts die Sündenböcke spielen zu müssen dafür, dass die meisten Fragen, die die Betroffenen umtreiben, immer noch nicht beantwortet werden können, ist offenkundig wenig attraktiv.
Es wird spannend sein zu beobachten, wie UNH, FFR und Landesregierung diese komplett verpfuschte Ausschreibung „mit leichten Modifikationen“ noch retten wollen.
Sehr wahrscheinlich wird es ihnen aber gelingen, einen faulen Kompromiss zu finden, der es ihnen erlaubt, das Projekt noch irgendwie zu einem Abschluss zu bringen. Es eilt ja nicht: die „geschätzte Dauer“ des Teilprojekts wird in Punkt 5.1.3 mit „48 Monate“ angegeben, und in vier Jahren kann viel passieren.
Die von Ultrafeinstaub Belasteten im Flughafen-Umfeld ahnen ja sowieso, dass diese Partikel ihrer Gesundheit nicht gut tun, und was sie genau anrichten, verstehen ohnehin die wenigsten. Dass es ein paar Jahre länger dauern wird, bis die Grundlagen für die Definition von Grenzwerten für diese Belastung gelegt sind und dann auch durchgesetzt werden, wird zwar für viele vermeidbare zusätzliche Krankheitstage und Todesfälle sorgen, aber andererseits kann der Flugverkehr sich dadurch vielleicht ja noch so lange ungestört entwickeln, bis die Klimakatastrophe dem endgültig ein Ende setzt. Das verspricht noch einige Jahre reichlich Profit, und die, die heute derartige Entscheidungen treffen, werden dann sicher nicht mehr zur Verantwortung gezogen.
Eine Alternative dazu gibt es natürlich auch: ein Konzept für eine sinnvolle Wirkungsstudie liegt in Form des Ergebnisses der Designstudie auf dem Tisch. Ergänzt um Untersuchungen zur spezifischen Toxikologie der ultrafeinen Partikel aus Flugzeugtriebwerken und die gesundheitlichen Auswirkungen bei extrem hoch belasteten Personen auf dem Flughafenvorfeld liessen sich daraus umfassende und qualitativ neue Aussagen über die gesundheitlichen Wirkungen von UFP aus unterschiedlichen Quellen abhängig vom jeweiligen Grad der Belastung gewinnen. Dies wäre ein wichtiger Schritt zur Festlegung von Belastungsgrenzwerten, die die gesundheitlichen Risiken für die Betroffenen im Umfeld von UFP-Quellen wie Flughäfen, Strassenverkehr und Industrieanlagen minimieren können und die Grundlage für die Durchsetzung von Minderungsmaßnahmen liefern können.
Das wäre ein Weg, der gegangen werden könnte in einer Welt, in der „Sicherheit“ Leben in einer gesunden Umwelt und einem stabilen Klima meint, nicht ungehemmte Profitmacherei und Rüstungswahn. Eine Welt also, von der wir uns aktuell immer weiter entfernen.